* 03. September 1857 in Meierhof (bei Beverstedt, heute Landkreis Cuxhaven), † 22. März 1923 in Hausneindorf
Ernst Röver entstammte einer norddeutschen Orgelbauerfamilie. Sein Vater hatte zunächst eine Werkstatt in Meierhof und siedelte mit dieser 1860 nach Stade über. Beide Söhne wurden ebenfalls Orgelbauer und stiegen 1877 als Teilhaber in die Werkstatt des Vaters ein, die fortan den Namen „Johann Hinrich Röver & Söhne OHG“ trug. Während der Bruder Carl Johann Heinrich die Werkstatt nach dem Tod des Vaters weiterführte, ließ sich Ernst Röver im September 1884 in Hausneindorf, einem kleinen Dorf bei Quedlinburg, nieder und übernahm dort die renommierte Orgelbauwerkstatt von Emil Reubke, der im selben Jahr unerwartet an einer Lungenentzündung gestorben war.

(Die unterstrichenen Begriffe finden sich im Orgelglossar.)
Sowohl die Rövers in Stade als auch Emil Reubke hatten sich unabhängig voneinander mit dem System der Kastenlade beschäftigt. Dieser neue Windladentyp entsprach eher den Anforderungen des voluminösen und majestätischen spätromantischen Klangideals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die bisher vorherrschende mechanische Schleiflade. Während die Rövers jedoch mit mechanischen Kastenladen experimentierten, entwickelte Emil Reubke bereits eine pneumatische Kastenlade und baute zwischen 1881 und 1884 sechs Orgeln nach diesem Prinzip. Er wurde damit zum Vorreiter der Pneumatik im Orgelbau (vgl. Wille 2017, S. 84–87).
Ernst Röver muss bereits in Stade einen direkten Eindruck von Reubkes Fortschritt in der Windladentechnik bekommen haben, da dieser 1883 den Auftrag erhielt, für die St.-Gertrud-Kirche in Hamburg Uhlenhorst eine dreimanualige Orgel mit 46 Registern nach diesem System zu bauen, und dies quasi vor Rövers Haustür. Es liegt nahe, dass die „Pionierleistung von Emil Reubke auf dem Gebiet der pneumatischen Orgel“ (ebd.) einer der Beweggründe für Röver war, die Werkstadt in Hausneindorf und damit das Know-how im pneumatischen Orgelbau zu übernehmen.
Nach Reubkes Tod führte Röver den Orgelneubau in Hamburg zu Ende und lege damit den Grundstein für eine „beispiellose Karriere“ (vgl. Günther 2004, S. 123). Mit „Erfindungsgeist und Kombinationsgabe“ (ebd., S. 122) war es ihm gelungen, das System der pneumatischen Kastenlade zu perfektionieren und die bei großen Orgeln unausweichliche Verzögerung zwischen Tastendruck und Ansprache der Pfeifen durch Umkehrung der Luftdruckverhältnisse (Abstrom-Pneumatik) zu beseitigen.
Schnell begann der Betrieb zu wachsen. Übernahm Röver von Reubke nur etwa fünf Mitarbeiter, waren es 1914 annähernd 25. Da die alte Werkstatt Reubkes in Hausneindorf bald zu klein wurde, baute Röver bis 1890 direkt daneben eine neue Produktionshalle mit einem zweigeschossigen „Orgelsaal“ zum Probeaufbau ganzer Orgeln (vgl. Günther 2004, S. 124). Zudem setzte er auf Dampfbetrieb in seiner Werkstatt und erweiterte den von Reubke übernommenen Maschinenpark. Außerdem verschloss er sich nicht der serienmäßigen Herstellung vorgefertigter Einzelteile für seine zahlreichen Aufträge im Raum Hamburg wie im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts, obwohl er sich nun – wie andere große Orgelbaufirmen auch – den Vorwurf einer fabrikmäßigen Herstellungsweise, die angeblich den Instrumenten ihre „Einzigartigkeit“ nahm, gefallen lassen musste. Während sich Friedrich Ladegast in Weißenfels auf die modernen Produktionstechniken nicht uneingeschränkt einlassen mochte und damit ab 1890 den Niedergang seines Unternehmens beförderte, erlangte Rövers Werkstatt bald überregionale Bedeutung bis hin zu einem Orgelneubau für die deutsch-reformierte Kirche in Moskau im Jahr 1898.

Über 200 Orgelneubaubauten verließen die Hausneindorfer Werkstatt bis 1914, ab 1893 mindestens 5 und ab 1911 mehr als 10 neue Instrumente pro Jahr, undenkbar zu Zeiten des rein handwerklichen Orgelbaus bis etwa 1850. Dabei zeigte Ernst Röver ein ausgesprochenes Qualitätsbewusstsein in Bezug auf die von ihm verwendeten Materialien. Ein Höchstprozentsatz an Zinn in den Metallpfeifen, Eichenholz in hoher Qualität für Holzpfeifen und Gehäuse sowie aus den USA importiertes, besonders hartes Holz (Pitch Pine) für die Kastenladen machten seine Orgeln extrem langlebig. Auch nach hundert Jahren erweisen sich besonders die Kastenladen, in deren Innerem alle wichtigen Funktionselemente vor Staub und Witterungseinflüssen geschützt sind, als zuverlässig und störunanfällig. Durch diese Technik ließen sich zudem störende Trakturgeräusche beim Spielen vermeiden (vgl. Günther 2004, S. 124).
Rövers Orgeln werden sowohl in der zeitgenössischen Literatur als auch von heutigen Experten wegen ihrer Klangqualität gerühmt, die schon bei seinen frühen Instrumenten erkennbar ist „durch den auffallenden Charakter der einzelnen Klangfarben, die sehr individuell herausgearbeitet sind und dennoch zu unendlich vielen Schattierungen verschmelzen“ (Günther 2004, S. 124). Ernst Röver baute zahlreiche kleine Dorforgeln, aber auch große dreimanualige Instrumente mit über 100 Registern, beispielsweise für die Nikolaikirche in Hamburg oder den Magdeburger Dom, die allerdings beide dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer fielen. Die letzten beiden Orgeln Ernst Rövers entstanden 1916 und 1919, da mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Geschäfte eingebrochen waren. Röver führte die Werkstatt bis 1921 fort, ab 1920 sind aber nur noch Reparaturen nachgewiesen.
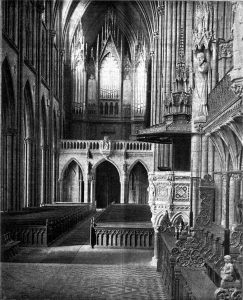
Ernst Röver war zweimal verheiratet, aus den Ehen gingen drei Töchter und zwei Söhne hervor. Während Hans Röver, ein Flugzeugbauer und Flugpionier, im 1. Weltkrieg ums Leben kam, ging der Erstgeborene, Ernst junior, als Großgrundbesitzer nach Tansania. Somit trat keiner der Söhne in die Fußstapfen des Vaters und die Orgelbautradition in Hausneindorf erlosch mit dem Tod Ernst Rövers im Jahr 1923 nach einem Schlaganfall.
Ernst Röver war kurioserweise Inhaber des Kaiserlichen Reichspatens für einen Flugzeugrumpf, den sogenannten Röver-Rumpf (1912), da sein Sohn Hans zu diesem Zeitpunkt noch zu jung für eine Patentanmeldung war.
In Sachsen-Anhalt sind noch 57 Röver-Orgeln erhalten (vgl. Günther 2004, S. 124), darunter die Orgeln in der Marktkirche St. Benedikti in Quedlinburg (1888), der St.-Petri-Kirche in Hausneindorf (1892, Rövers Vorführinstrument, von ihm selbst 1914 modernisiert und um vier Register erweitert) und im Magdeburger Domgymnasium (1900) sowie die Orgel der St.-Bonifatius-Kirche in Ditfurt , das „mit Abstand […] repräsentativste erhaltene Werk Ernst Rövers“ (ebd., S. 129). Zu dieser Orgel heißt es im Abnahmegutachten des Komponisten und Orgelsachverständigen Prof. Rudolph Palme aus dem Jahr 1903: „Soll man die famose Tongrundlage der Principale loben, oder sein Wohlgefallen an den schönen Gambenstimmen ausdrücken, von den glanzvoll wirkenden Rohrwerken sprechen, den sanften Stimmen im Oberwerk besonderen Beifall spenden? Man wird eben durch alle Tonwirkungen gefesselt, ganz besonders durch die herrlichen Klangeffekte der Oberwerkstimmen höchst sympathisch berührt. Dazu entwickelt das volle Werk, getragen durch die gute Akustik des schönen Kirchenraumes, eine große Noblesse, Kraft und Fülle des Tons. Die Tonhöhe der Orgel ist ein Normalton, die Stimmung rein und präzis, die Spielart sehr angenehm und bequem. Die ganze Orgel ist ein Meisterwerk ersten Ranges, Material und Arbeit sind ganz vorzüglich, die Intonation charakteristisch, sehr schön die Tonwirkung in den einzelnen Stimmen, wie im vollen Werke ganz ausgezeichnet.“ (Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=W29ohiMYk-Q)
Im Frühsommer 2020 stellte die Halberstädter Firma Reinhard Hüfken eine aus zwei verschiedenen Röver-Orgeln zusammengefügte Orgel für die Bernburger Marienkirche fertig. Sie entstand aus restaurierten Teilen der bis auf den Prospekt und einige Pfeifen nicht mehr erhaltenen Bernburger Röver-Orgel aus dem Jahr 1902 sowie eines in den 1970er-Jahren durch ein Feuer z. T. zerstörten und nicht mehr spielbaren Instrumentes aus Alsleben. Diese gleichermaßen alte und neue Röver-Orgel ist als „gläserne“ Orgel konzipiert und begehbar. Sie kann damit auch für pädagogische Zwecke genutzt werden. Das Instrument wurde am 11. Oktober 2020 mit einem Festprogramm eingeweiht (s. Link unten).

In Hausneindorf gibt es heute ein Orgelbauermuseum, getragen vom Heimatverein Hausneindorf e. V., das sich dem Leben und Wirken der drei regionalen Orgelbauer Adolph und Emil Reubke sowie – mit einem eigenen Ausstellungsraum – Ernst Röver widmet.
Klangbeispiele
Variation (Scherzo) über “In Dir ist Freude” (Peter Ewers improvisiert auf der Ernst-Röver-Orgel von 1903 in der Bonifatiuskirche in Ditfurt, mit ausführlichen Informationen zur Orgel, s. Zit. oben)
Peter Ewers plays Improvisation on Ernst Röver Organ (1903) (mit Video-Tour durch die Ditfurter Kirche)
Literatur
Martin Blindow, Die Orgelbauwerkstatt Ernst Röver, Forschung und Wissenschaft Bd. 7, LIT Verlag, Berlin 2020.
Martin Günther, Der Hausneindorfer Orgelbauer Ernst Röver. Eine fast vergessene Größe des spätromantischen Orgelbaus, in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, 2004 Heft 2, S. 121–138.
Sigrid Hansen, Art. „Röver, Friedrich Wilhelm Ernst“, in: Magdeburger Biographisches Lexikon, http://www.uni-magdeburg.de/mbl/Biografien/1690.htm (abgerufen am 09. Juli 2018).
Lutz Wille, Die Orgelbauwerkstatt Reubke in Hausneindorf am Harz und ihre Instrumente 1838–1884, Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle 2017.
Links
Heimatverein Hausneindorf e. V.
Restaurierte Orgel in Bernburg eingeweiht
Anregungen für den Unterricht
Zahlreiche erhaltene Röver-Orgeln in Sachsen-Anhalt laden im Rahmen eines Orgelprojektes zur Erkundung ein. Blanko-Arbeitsblätter zum Ausfüllen (für Grundschule und ab Sekundarstufe I) für Exkursionen zu regionalen Orgeln im Unterricht (Erstellung von Orgelsteckbriefen) finden sich auf dem Bildungsserver des Landes unter Regionalkultur.
Vorausgehen könnte ein Besuch des Orgelmuseums in Hausneindorf, verbunden mit einer Besichtigung der Orgel in der benachbarten Kirche (s. pädagogische Angebote des Museums).
SM 2018, letzte Aktualisierung Oktober 2020